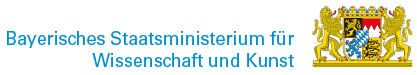Langeweile als ästhetische Grunderfahrung?
„Zum Gähnen“, „sterbenslangweilig“, „todeslangweilig“, „sehr zäh“ und „furchtbar langweilig“ – diese Urteile zitierte Johannes Franzen aus Rezensionen auf digitalen Platt-formen wie Goodreads. Doch der Text, der hier so einhellig verflucht wird, ist ein unbestrittener Klassiker der deutschen Literaturgeschichte: Theodor Fontanes Effi Briest. Schon während Franzen das in einer ersten Lesung aus Wut und Wertung (2024 bei S. Fischer erschienen) auflöst, meinte man im Publikum gegensätzliche Reaktionen zu spüren: erleichterte Zustimmung einerseits, eine gewisse Empörung bei anderen.
Umso interessanter und erhellender war dann das Gespräch, das sich über solche Klassikerschelte ergab. Mit Stephanie Waldow, Sprecherin des Elitetudiengangs „Ethik der Textkulturen“, und Matthias Löwe, Inhaber des Lehrstuhls für Neuere deutsche Literaturwissenschaft in Augsburg, fragte Johannes Franzen nach möglichen Gründen: Mag es eine Rolle für die Wertung spielen, dass die Rezeption berühmter Werke oft – man denke an Schullektüren und universitäre Leselisten – nicht ganz freiwillig erfolgt? Verhindert das Label „Klassiker“ vielleicht manchmal, dass wir uns ohne Vorurteile einem Text nähern? Wie kommt es überhaupt zu den Wertzuschreibungen, die einen Kanon bilden? Wer und mit welcher Autorität entscheidet eigentlich, welche Kunst über Jahrhunderte sichtbar bleibt und welche nicht?
Kunstfreiheit zwischen Provokation und Heldengeschichte
In einer zweiten Lesung erinnerte Johannes Franzen an die Debatte um Eugen Gomringers Gedicht cuidad (avenidas). Dieses schmückte die Fassade der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Mit dem Hinweis, der Text inszeniere einen männlich bewundernden Blick auf Frauen, verlangte eine studentische Petition, ihn aus dem öffentlichen Raum zu entfernen. In der folgenden heftigen Kontroverse wurde den Studierenden Zensur und „barbarischer Schwachsinn“ vorgeworfen. Demgegenüber bildete sich ein mächtiges Bündnis aus Kulturjournalismus und Autoren, das für sich in Anspruch nahm, die Kunstfreiheit vor den Studierenden zu verteidigen. Auf der Bühne war man sich einig, dass solche Auseinandersetzungen differenzierter betrachtet werden müssten. Schließlich handle es sich auch um einen Fall, bei dem man von „Phantomzensur“ sprechen könne.
Am Ende stand auch die Erkenntnis, dass die Überlegungen über Wut und Wertung auch viele Fragen von Ethik und Ästhetik betreffen, die den Elitestudiengang seit langem beschäftigen: Wer über Geschmack streitet, streitet implizit auch über Fragen der Moral.
Text: Elitestudiengang „Ethik der Textkulturen“