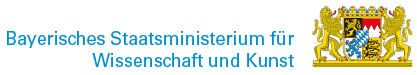Durch das Elitenetzwerk konnte ich meinem Herzensthema nachgehen und daran forschen, welchen toxischen Einfluss KI heute auf das Leben marginalisierter Menschen hat – und vor allem wie das verändert werden kann.
Eva Gengler • Internationales Doktorandenkolleg
Eva Gengler ist vieles zugleich: Wissenschaftlerin, Unternehmerin, Künstlerin – und eine Frau, die sich mit Leidenschaft für eine gerechtere digitale Zukunft einsetzt. Seit 2021 promoviert sie im Rahmen des Internationalen Doktorandenkollegs „Business and Human Rights“ an der FAU Erlangen-Nürnberg. Parallel dazu ist sie Co-Founderin und Geschäftsführerin der enableYou Consulting GmbH, einer Organisationsberatung mit dem Ziel, Unternehmen in Richtung Selbstorganisation zu begleiten. In ihrem kleinen, aber feinen Kunstlabel „Flavours of Colour“ vermarktet sie eigene Kunstdrucke und findet kreativen Ausgleich – auch wenn die Zeit dafür momentan knapp ist.
In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit der Schnittstelle zwischen Künstlicher Intelligenz und Macht. Bereits in ihrer Masterarbeit behandelte sie den Einsatz von KI im Recruiting bei Amazon – ein Bereich, in dem algorithmische Diskriminierung besonders deutlich wird. Im Rahmen ihrer Promotion, die kurz vor dem Abschluss steht, geht sie der Frage nach, warum KI-Systeme überhaupt Vorurteile bzw. Bias entwickeln, obwohl sie gemeinhin als neutral gelten. Eva Genglers Forschung zeigt auf, wie bestehende ungerechte Machtstrukturen durch KI nicht nur abgebildet, sondern oft auch verstärkt werden – etwa, wenn Lebensläufe von Frauen durch die KI bei Bewerbungsprozessen systematisch benachteiligt werden oder visuelle KI-Modelle stereotype Geschlechterbilder reproduzieren. „Bestehendes wird durch die Künstliche Intelligenz also automatisiert“, erklärt Eva Gengler. Mit der feministischen KI setzt sie hier an: „Der Status quo ist nicht gerecht und wir müssen ihn ändern. Das hat ein aktivistisches Element.“
Um diese Veränderung zu erreichen, beschäftigt sich Eva Gengler mit KI-Governance und erprobt, wie man die KI mit feministischen Werten füttern kann, nicht nur um die KI weniger ungerecht zu machen, sondern auch um die konventionellen Macht- und Gesellschaftsstrukturen insgesamt zum Positiven zu verändern. So erzählt sie beispielsweise begeistert von neuen Ansätzen zu Bewerbungsprozessen, bei denen man die Möglichkeiten von KI nicht zur Auswahl passender Bewerbungen auf eine bestimmte Stelle nutzt, sondern bei denen es gar keine Stellenausschreibungen im klassischen Sinn mehr gibt. Stattdessen wolle man eine Jobplattform entwickeln, auf der sowohl die Bewerberinnen und Bewerber als auch die Unternehmen ein Profil anlegen und verschiedene Fragen beantworten. Anhand dieser Profile finde die Plattform dann das passende Match zwischen Person und Unternehmen. Rückhalt für ihre Ideen zu feministischer KI findet sie nicht nur in Netzwerken wie der feminist AI-Community, sondern insbesondere auch im Umfeld des Internationalen Doktorandenkollegs.
Der Weg ins Elitenetzwerk Bayern war für sie ein Meilenstein. „Die Entscheidung zu diesem Promotionsprogramm war eine der besten meines Lebens“, sagt sie heute. Die Förderung habe ihr nicht nur die Freiheit gegeben, ihrem Herzensthema nachzugehen, sondern auch wertvolle Kontakte ermöglicht – sowohl zu renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern als auch zu den anderen Promovierenden: „Die Internationalität und Interdisziplinarität waren für mich ein riesiger Gewinn und die Verbindungen mit den Menschen, die entstanden sind, sind mir viel wert.“
Neben der Wissenschaft ist Eva Gengler auch als Speakerin aktiv und widmet sich verstärkt der öffentlichen Aufklärung zu KI. Dieses Engagement spiegelt sich unter anderem in ihrer Nominierung für den BRIGITTE Award 2025 in der Kategorie Future Economy, ihrer Auszeichnung als BayFiD-Rolemodel des Bayerischen Digitalministeriums (2024) und ihrer Aufnahme in die Porträtreihe „Bayerns Frauen – Jede anders stark“ durch das Sozialministerium wider. Für besondere wissenschaftliche Leistungen hat sie 2023 den Hermann Gutmann Preis erhalten. Trotz dieser Auszeichnungen empfindet sie sich selbst nicht als „Elite“ im klassischen Sinne. Der Begriff sei ihr zunächst fremd gewesen, fast einschüchternd. Doch im Laufe ihrer Zeit im Doktorandenkolleg „Business and Human Rights“ hat sich ihr Verständnis gewandelt: Das Elitenetzwerk Bayern bedeutet für sie heute nicht Abgrenzung, sondern ein inspirierendes Umfeld mit engagierten Menschen, die gemeinsam lernen, forschen und sich gegenseitig fördern.
Was sie antreibt, ist ein tief verwurzelter Gerechtigkeitssinn. „Ich nehme viel Ungerechtigkeit wahr“, sagt sie. Ihre Arbeit ist durchzogen von der Überzeugung, dass Technologie kein neutraler Raum ist – und dass es unsere Aufgabe ist, sie so zu gestalten, dass sie nicht weiter Ungerechtigkeit zementiert. „Mit Feminismus eckt man an“, sagt sie selbstbewusst. Doch genau das ist auch die Stärke ihrer Position: Sie stellt den Status quo infrage und gibt Denkanstöße, wie wir als Gesellschaft mit KI umgehen sollten – eine Aufgabe, die sie sich auch für ihre künftige Karriere auf die Fahnen geschrieben hat. Ob sie dieses Ziel im Rahmen einer Karriere als Forscherin an der Hochschule verfolgen wird oder lieber in einem Unternehmen arbeiten will, mit der Möglichkeit auch nebenbei selbstständig und aktivistisch tätig zu sein, möchte Eva Gengler momentan noch nicht festlegen.
Eva Gengler steht exemplarisch für eine neue Generation von Wissenschaftlerinnen, die nicht nur forschen, sondern auch gestalten wollen – mutig, kreativ und mit dem klaren Ziel, die Welt ein Stück gerechter zu machen.