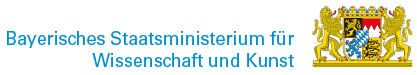FANE ist 2015 von vier Gründungsmitgliedern – Prof. Dr. Sean McGrath (Philosophy, Memorial University), Prof. Dr. Barry Stephenson (Religious Studies, Memorial University), Prof. Dr. Kyla Bruff (Philosophy, Carleton University) und PD. Dr. Joachim Rathmann (Geographie, Philosophie, Universität Augsburg) – ins Leben gerufen worden. Sie alle vereint die tiefe Überzeugung, dass die Ursache unserer modernen gesellschaftlichen Krisen in der Konsumgesellschaft liegen, so Professor Barry Stephenson, einer der vier Gründer, bei der Eröffnung der Summer School. Gemeinsam mit uns – vier internationalen Studenten – trafen sich die vier Hochschullehrer eine Woche lang in der Nähe der Stadt Cupids in Neufundland. Auf der abseits von Cupids, direkt am Meer ge-legenen 100 Hektar großen Ranch Burnt Head Retreat des anderen Mitbegründers Professor Sean McGrath wollte die kleine Gruppe herausfinden, wie es sich abseits von der Zivilisation ohne großartigen Luxus leben lässt.
Historisch ist das Bunt Head Retreat für FANE von großer Bedeutung. Die Bucht war bis ins 20. Jahrhundert das von den Briten am längsten durchgängig besiedelte Stück Land in Nordamerika. Tagebücher, wie das vom 1893 geborenen John Morgan, berichten von dem einfachen, aber glücklichen Leben der Siedler in den 1910er Jahren. Kurz danach sah sich die Siedlung gezwungen, weiter ins Landesinnere zu ziehen, weil die große Industriefischerei ihre Lebensgrundlage bedrohte. Die einfache Lebensweise von John Morgan war uns während der FANE Field School ein Vorbild. Seine detaillierten Beschreibungen der Landschaft und der Lebensweise ließ uns die Präsenz der Vergangenheit spüren.
Zurück zu den Wurzeln – Leben wie die Siedler im Burnt Head
Uns Studenten standen im sogenannten „orchard“, also dem Obstgarten, Zelte zur Verfügung. Ruinen von Steinmauern zeugten dort von der landwirtschaftlichen Nutzung dieser Gärten durch die Siedler. Etwa eine Meile entfernt und nur durch einen schmalen Waldweg verbunden befand sich das Haupthaus, in dem allein es Solarstrom und einen Gas-Herd gab. Während Trinkwasser über einen offiziellen Wanderweg im 20 Minuten entfernten Cupids geholt werden musste, sorgte eine einzig durch Gravitation funktionierende, fünf Meilen lange Wasserleitung für mehr oder weniger fließendes Spülwasser.
Ernährt haben wir uns zum Teil durch die aufwendig ins Bunt Head getragenen Einkäufe, ein Fokus des Projekts bestand aber darin, insbesondere von dem zu leben, was die Natur uns direkt zur Verfügung stellt. So ist die Gruppe, wie schon die Siedler im Burnt Head, früh morgens mit einem kleinen Boot zum Fischen rausgefahren. Praktische Erfahrung sammelten wir Studenten während des Angelns, aber auch durch das filetieren der Fische am Strand. Glücklicherweise wuchsen im Retreat unzählig viele Blaubeeren, die uns den Tag versüßten. Zudem hatte Sean, der seit 15 Jahren an seinem Haus im Retreat baut, immer wieder handwerkliche Aufgaben zu erledigen. So ersetzten vier von uns allein durch Muskelkraft den Stützpfeiler im Haus durch einen 200 Kilogramm schweren Querbalken.
Wo Umweltphilosophie auf Atlantikwellen trifft
Neben diesen praktischen Erfahrungen gehörten zur Summer School die täglichen so genannten lectures. Klassische Texte aus der Umweltphilosophie, etwa Thoreau, Schuhmacher, Snyder oder Hildebrandt, wurden gelesen und diskutiert. Neben den offiziellen lectures und der handwerklichen, praktischen Arbeit hatten wir Studenten zudem Zeit, im kalten Atlantik baden zu gehen, auf der Terrasse zu lesen oder kleine Wanderungen zu unternehmen.
Nach drei Tagen startete der zweite Teil der Field School. Auf einer wissenschaftlichen Tagung in Cupids präsentierten etwa 15 internationale Sprecher ihre paper im Bereich der Umweltphilosophie. Auch wir Studenten hatten die Möglichkeit, zu präsentieren. Ich selbst sprach zu der Rolle der Umwelt und ihres deterministischen Einflusses auf antike politische Krisen im Geschichtswerk des stoischen Philosophen Poseidonios. Nach der 2-tägigen wissenschaftlichen Tagung wurde die Summer-School beendet.
Weitere Informationen zur MWP-Programmlinie „Forschung vor Ort“ finden Sie hier.
Text: Etienne Pablo Dame, Max Weber-Programm